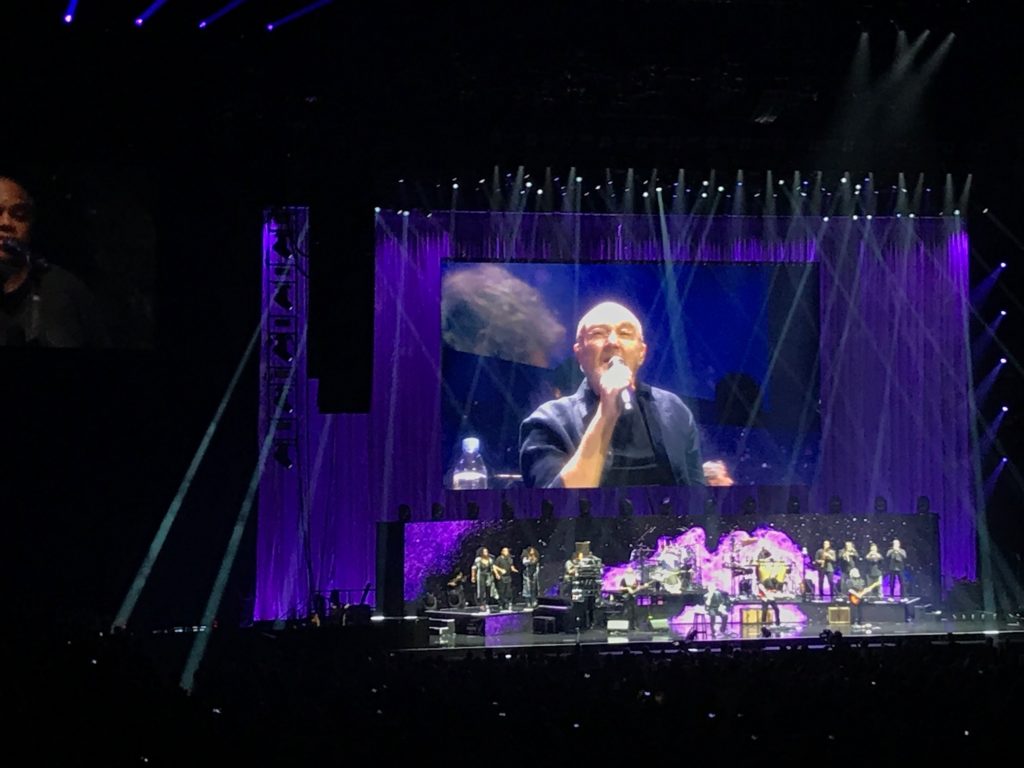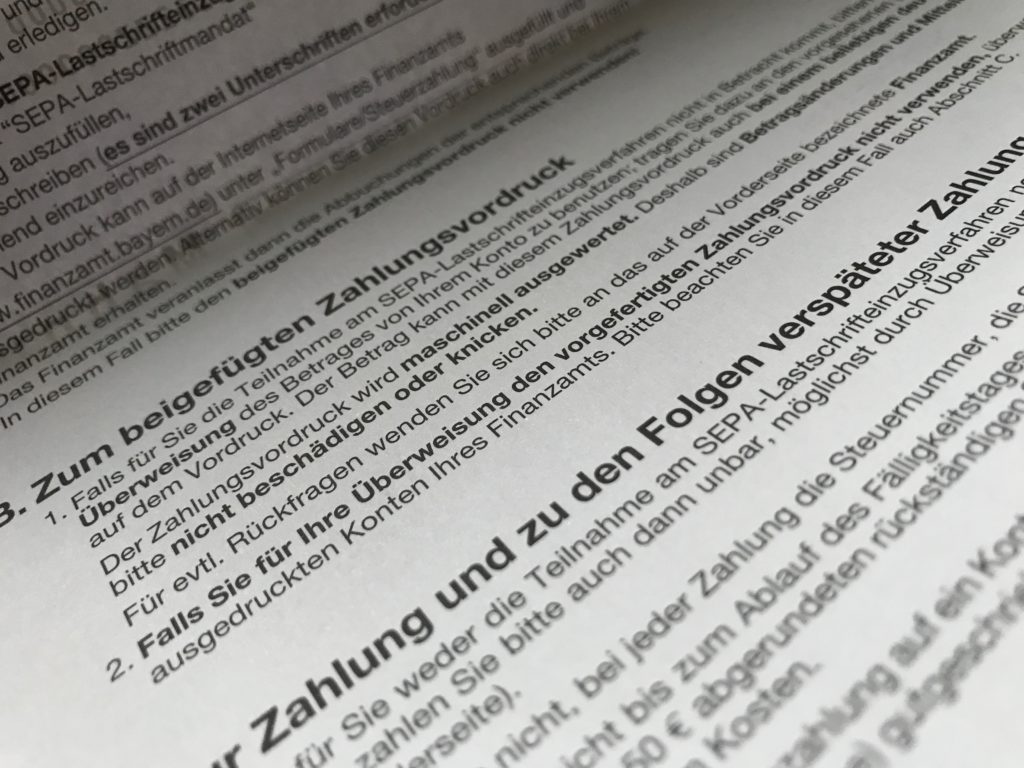Gelesen habe ich es quasi als Vorbereitung aufs Älterwerden und genau genommen habe ich es auch nicht gelesen, sondern mich eher durchgequält. Ich fand es alles in allem eher unlustig und konnte der Aussicht, später mal zwangsweise konservativ zu werden, nicht sehr viel abgewinnen. Außerdem war ich damals der Auffassung, dass Haltung Haltung ist und dass man die nicht einfach wegwirft wie ein altes Lacoste-Shirt (sowas machen eben nur Konservative). Ich hatte mich selbst irgendwo in eine linksliberale Ecke verortet und auch nicht vor, diese jemals zu verlassen. Was man halt so denkt, wenn man noch mitteljung ist und meint, alles im Leben würde für immer so bleiben wie es jetzt gerade ist.
Ein paar Jahre später, ich war dann nicht mehr ganz so jung, habe ich selbst ein Buch zum Thema Älterwerden geschrieben (Der 40jährige, der aus dem Golf stieg und verschwand).
Ich bemühte mich während des gesamten Schreibens, bloß nicht allzu Fleischhauerig zu klingen. Oder, noch schlimmer, wie Matthias Matussek, der seinen Wandel zum reaktionären Kauz ausführlich und öffentlich zelebriert. Überhaupt fand ich es etwas albern, wie man alternden Männern dabei zuschauen konnte, wie sie immer verbohrter, langweiliger, erwartbarer wurden. Konservativ eben. Rechts, die Seite, auf der man als halbwegs anständiger Mensch völlig unmöglich stehen kann.
Davon abgesehen haben solche Typen immer die gleiche Attitüde, egal ob sie nun noch links oder doch schon wieder ganz rechts stehen: Sie sind immer enorm überzeugt von sich selbst und ihren Meinungen. Jemandem wie Matussek ist es völlig egal, welche Position er gerade vertritt, er findet sie in jedem Fall richtig. Und sich selbst natürlich auch.
Ich war mir zudem völlig sicher, dass ich nie, nie, nie im Leben Sätze sagen werde, die Männer (und vor allem: Väter) meines Alters gerne sagen. Dumm nur, dass ich mittlerweile wahrscheinlich alle gesagt habe, außer: So lange Du Deine Füße unter meinen Tisch…der ist meine letzte moralische Bastion, die Grenze, die Rote Linie, die auf keinen Fall überschritten werden darf.
Aber sonst? Ich finde Teenager und inzwischen sogar manchmal junge Studenten gelegentlich grässlich. Ich finde, es fehlt ihnen an Disziplin und an Allgemeinwissen und an ungefähr allem anderen auch. Ich finde, dass an unseren Schulen gelegentlich völlig irrsinnige Zustände herrschen und fühle mich immer dann bestätigt, wenn mir meine Frau, zufällig Lehrerin, von ihrem Alltag erzählt. Über manche Gerichtsurteile schüttele ich den Kopf, weil ich sie für viel zu milde halte und…
STOP!
Immer, wenn ich mich bei diesen Gedanken ertappe, schüttele ich über mich selbst den Kopf. Ich rede daher wie mein Vater in seinen schlimmsten Zeiten und der war immerhin Berufssoldat. Das geht doch völlig unmöglich, dass man das wird, was man nie werden wollte, denke ich mir. Gut, das ist alles inzwischen 35 Jahre her und man kann sich selbst damit entschuldigen, dass man in den Jahren zwischen Pubertät und Halberwachsenemtum eine ganze Menge Unfug sagt, den man später nicht nur korrigieren darf, sondern ganz dringend sogar korrigieren muss. Unbelehrbarkeit und die Unfähigkeit, auch mal dazuzulernen, das sind schließlich keine Eigenschaften, die von übermäßiger Reife zeugen.
Die große Sorge: Mache ich jetzt den Fleischhauer?
Und jetzt gerade sitze ich hier und staune immer noch. Über die zurückliegenden Tage in Hamburg beim G20-Gipfel und mein eigenes Unverständnis für die Welt. Ich bin mir absolut nicht mehr sicher: Haben jetzt alle anderen einfach ein merkwürdiges Weltbild entwickelt oder habe ich mittlerweile eines, das zwar vom Matussek noch sehr weit entfernt ist, sich aber bedenklich dem Fleischhauer annähert? Ich ertappe mich beispielsweise dabei, dass mich ein Typ wie der Anwalt der Roten Flora in Hamburg um den Verstand bringt, wenn er solche Sachen sagt, die sinngemäß bedeuteten, dass ein bisschen Krawall und Randale völlig ok sind, aber nicht im eigenen Viertel.
Und ich könnte kotzen, wenn selbst meine heißgeliebte „Süddeutsche“ schreibt, dass es zwar formal betrachtet schon ok sei, wenn die Polizei Vermummte demaskieren will, man aber dennoch das Gefühl nicht loswerde, dass es „der Staat“ irgendwie auf eine Eskalation der Gewalt abgesehen habe. Ist klar, Kollegen: Man nennt eine Veranstaltung „Welcome to Hell“, rückt vermummt und mit Pflastersteinen in der Hand an – aber die Polizei hat es auf Eskalation angelegt. Vermutlich deswegen, weil es so viel Spaß macht, sich mit einer Horde vermummter, austrainierter und bewaffneter junger Männer zu prügeln.
Einer meiner Facebook-Kontakte hatte sogar einen Beitrag mit dem dämlichst möglichen aller dämlichen Titel geschrieben: Quo vadis, Rechtsstaat? Grundsätzlich habe ich ein Problem damit, Beiträge ernst zu nehmen, die mit „quo vadis“ beginnen. Der war aber ganz besonders unsinnig: Hamburg wird von einer vierstelligen Zahl vermummter Chaoten gebrandschatzt – und wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir überhaupt noch in einem Rechtsstaat leben.
Aus der „linken“ Ecke, von der ich vor Jahrzehnten dachte, man gehöre ihr als halbwegs denkender Mensch qua Geburt an, habe ich noch vieles anderes Verstörendes gehört in diesen Tagen. Das sehr linke „Neue Deutschland“ schrieb, eigentlich hätten die Chaoten ja nur ein kleinbürgerliches Idyll mit den ganzen Mittelklassewagen zerlegt. Eine nicht ganz unbekannte Feministin wunderte sich bei Facebook, dass sich ganz Deutschland über ein paar brennende Autos aufrege, niemand aber über Zehntausende Männer, die regelmäßig ihre Frauen krankenhausreif prügeln. Ich lese, dass die Polizei-Strategie gescheitert sei und dass „die Politik“ es ja auch ein bisschen selber darauf angelegt habe: Ein Gipfel in der Großstadt Hamburg, das müsse ja schief gehen. Notabene: Vor zwei Jahren haben sich die Gegner solcher Veranstaltungen aufgeregt, als der G8-Gipfel im ganz und gar ungroßstädtischen Schloss Elmau stattfand.
Ab und an ertappe ich mich dennoch bei einem gefühlten inneren Zwang: Ich muss solche Positionen doch wenigstens halbwegs richtig finden. Oder zumindest keine völlig entgegengesetzte Position einnehmen. Weil das ja so eine Art Verrat wäre. An mir selbst und an der Kultur, in der ich vermeintlich aufgewachsen bin. Ist das nicht außerdem Opportunismus und weiß Gott nicht alles Schreckliche, wenn man in diesen Kategorien denkt?
Antworten darauf habe ich keine. Nur eine Ahnung: Fürs Erste werden mich diese Fragen noch eine ganze Zeit beschäftigen. Spätestens dann, wenn man mal wieder ein paar Teenagern Standpauken halten muss.