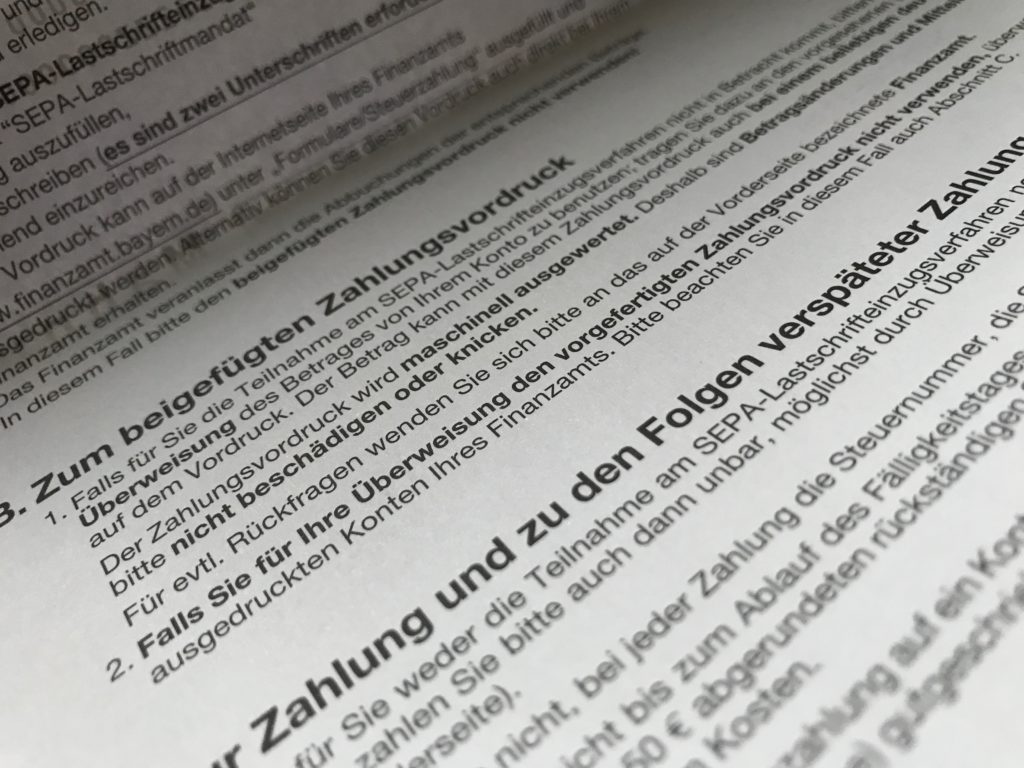Vermutlich hat Phil Collins bei seinen nun abgeschlossenen Konzerten in Köln nicht das Publikum gehabt, das er verdient gehabt hätte. Möglicherweise bekommt sogar kein Künstler, der ein Publikum jenseits der 40 anzieht, das ihm gebührende Publikum. Weil solche Konzertbesuche gerne ausarten in ein Adabei-Event.
Adabei ist eine bayerische Dialekt-Verballhornung und heißt so viel wie: Auch dabei gewesen. Mit dem Begriff bespöttelt man ein Publikum, das sich für die eigentliche Veranstaltung nicht wirklich interessiert, sondern das eben auch nur dabei gewesen sein will. Ich war bei Phil Collins, GunsNRoses, den Stones, Depeche Mode. Man findet ein solches Publikum natürlich auch anderswo, im Fußball in einer Lounge in der Allianz Arena oder auf den wirklich teuren Plätzen der Champions League oder einer Fußball-WM.
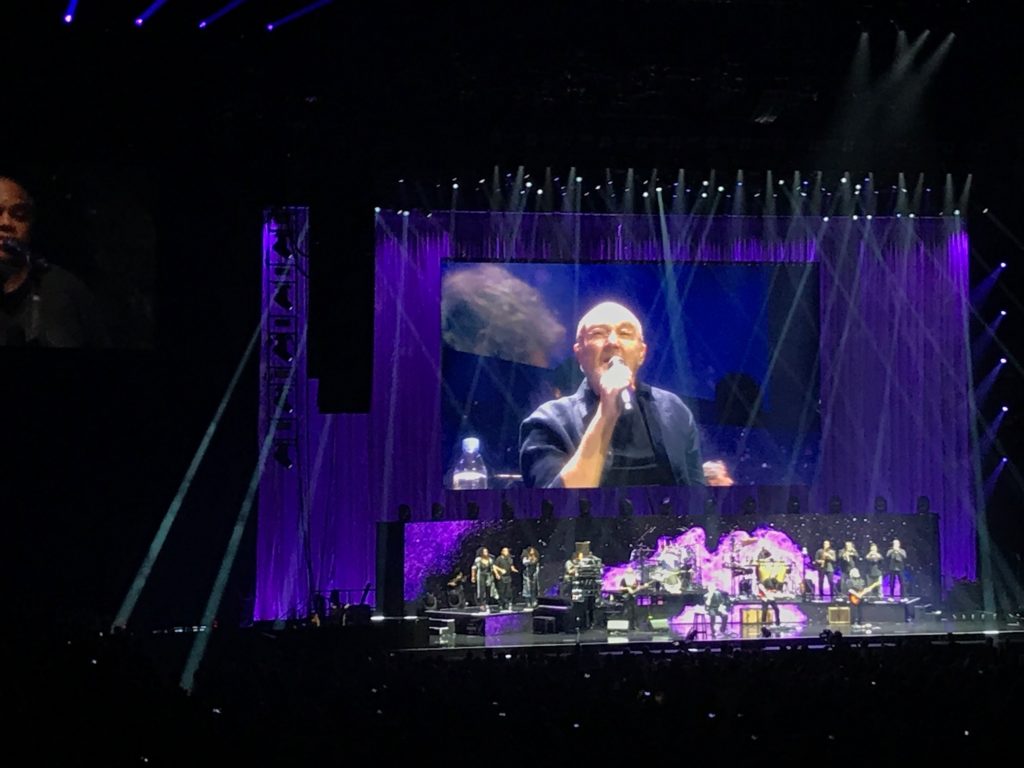
Hier gilt das Prinzip: Nicht einfach nur dabei gewesen sein, sondern möglichst teure Plätze ergattern. Beim bedauernswerten Phil Collins haben sie irgendwann mal mit der Publikumskamera unbeabsichtigt ein sehr spezielles wie typisches Exemplar der Adabei-Gattung gezeigt: Irgendwas zwischen 40 und 50, front of the stage für rund 500 Euro. Front of the stage ist bei Konzerten in etwa das was beim Fußball die Loge ist. Da sitzt man ganz besonders teuer und man kann fest davon ausgehen, dort das ahnungsloseste Publikum anzutreffen.
Der mit der Kamera eingefangene Typ jedenfalls wurde bei einem herzhaften Gähnen in Großaufnahme gezeigt, als gerade die restlichen 15999 Zuschauer in der Arena so richtig in Fahrt kamen: Die ganze großen und mitklatschfähigen Collins-Nummer laufen und unser Adabei mit dem 500 Euro-Ticket gähnt. Das in Großaufnahme ist die gerechte Strafe für jemanden, der zeigen will, dass er es zu so viel Kohle gebracht hat, sich bei Phil Collins (oder sonstwo, ist ja auch egal, Hautsache Event) front of the stage leisten zu können.
Vermutlich gehören solche Leute zu dieser Kategorie, die die Amerikaner in ihrem ausgeprägten Hang zum Sortieren upper middle class nennen. Vielleicht ein Vertriebler, ein Versicherungsmann, ein Geschäftsführer von irgendwas Mittelständlerischem. Die perfekte menschliche Nullnummer: überall dabei, aber nirgends mittendrin. Das sind solche Typen, die Musiker, Fußballer, Politiker oder Kinofilme gerne als „genial“ bezeichnen, ohne zu wissen warum und meistens sich selbst meinend.
In dieser Welt ist alles „genial“: Das neue Auto, die neue Freundin (von Ehefrauen trennen sich solche Typen gerne mal nach einer gewissen Zeit), Phil Collins, der FC Bayern. Genial, drunter tun sie es nicht, vielleicht auch wegen mangelndem Vokabular und dem Gefühl, man müsse die eigene Überlegenheit gegenüber dem nicht ganz so genialen Rest der Menschheit auch durch die Verwendung des Begriffs genial unterstreichen. Die gehen nicht zu Collins oder den Bayern wegen der Musik oder des Fußballs, sondern weil es Branchenführer sind, für die man schwer Tickets bekommt.

Wenn übrigens den Verwendern des Begriffs „genial“ nichts mehr einfällt, nennen sie eine Sache „Kult“. Das ist genauso nichtssagend, aber die klassenmäßig unter den Adabeis angesiedelten Leute wissen: Wenn der Adabei genialen Kult für 500 Euro gesehen hat, muss man die Waffen strecken und ihn einfach nur kultig genial geil finden.
Ich würde übrigens an dieser Stelle gerne betonen, dass ich das Publikum bei Phil Collins herzlich verachtet habe, selbst diejenigen, die nicht mit den 500-Euro-Tickets rumstolzierten. Das ist zwar etwas blöd, weil es sich dabei vorwiegend um meine eigene Generation handelt und irgendjemand mir den Vorwurf machen könnte, ich müsste mich so gesehen ja auch selbst ein bisschen verachten. Trotzdem muss man sich das wirklich mal vor Augen führen: Da gehen Menschen in ein Konzert, kaufen sich einen Teller Nachos mit klebriger Soße, bestellen sich ein Eis auf den Sitzplatz und laufen mit Plastik-Piccolos durch die Gegend.
Davon abgesehen sieht an bei einem solchen Konzert mit der eigenen Generation jede Menge Figuren, denen man vermutlich im echten Leben bei Banken, Versicherungen oder in Finanzämtern und damit tendenziell eher ungern begegnet. Der deutsche Mainstream, irgendwas zwischen 40 und 50. Meine eigene Generation, bei der man sich dann fragt, wie es nur soweit kommen konnte. Das fragt man sich bei sich selbst zwar auch gelegentlich. Aber ich kann mich selbst in solchen Momenten wenigstens damit beruhigen, nicht in einer Versicherung zu arbeiten, keine Kurzarmhemden zu tragen, bei Fußballspielen gerne da zu sein, wo die Stimmung ist und Konzerte immer noch wegen der Musik zu besuchen und bei den meisten sogar halbwegs textsicher zu sein.
Mr. Collins hat übrigens, um das wenigstens noch zu erwähnen, ein wirklich sehr, sehr schönes und berührendes Konzert gespielt. Vor allem im ersten Teil, in dem er sich ein paar Sachen rausgepickt hat, die nicht zu den Standards gehören und mit denen er die genialen Adabeis vermutlich etwas verschreckt hat. Das großartige „Hangin in long enough“ beispielsweise oder „You know and I know“.
Die Guten im Publikum, die es natürlich auch gegeben hat, waren vermutlich ziemlich berührt, als dieser alte, gebrochene und gebückte Mann, der eher zufällig noch am Leben ist, die Bühne betreten und sich auf seinen Stuhl gesetzt hat und dann zu singen begann, mit dieser immer noch einmaligen Stimme, die man nicht mögen muss, die aber eben einmalig ist. Der Mann hat große Popmusik geschrieben, sie gespielt, gesungen – und schließlich auch noch den zweitbesten Schlagzeuger der Welt mitgebracht: Nicolas Collins, seinen 16jährigen Sohn, der ein derart unfassbares Talent mitbekommen hat; so unfassbar, dass es der Adabei genial nennen würde.

Am Ende gehen sie dann alle wieder raus, in ihre Banken, Versicherungen oder Mittelstands-Firmen. Am Montag, Schlag 8, beginnt der Alltag wieder und sie werden ihre Umgebung beeindrucken mit den Erzählungen aus der front of the stage.
Collins, der alte Schelm, hat seine Biografie und seine Tour Not dead yet genannt. Etwas, was leider ein beträchtlicher Teil meiner Generation nicht von sich behaupten kann.